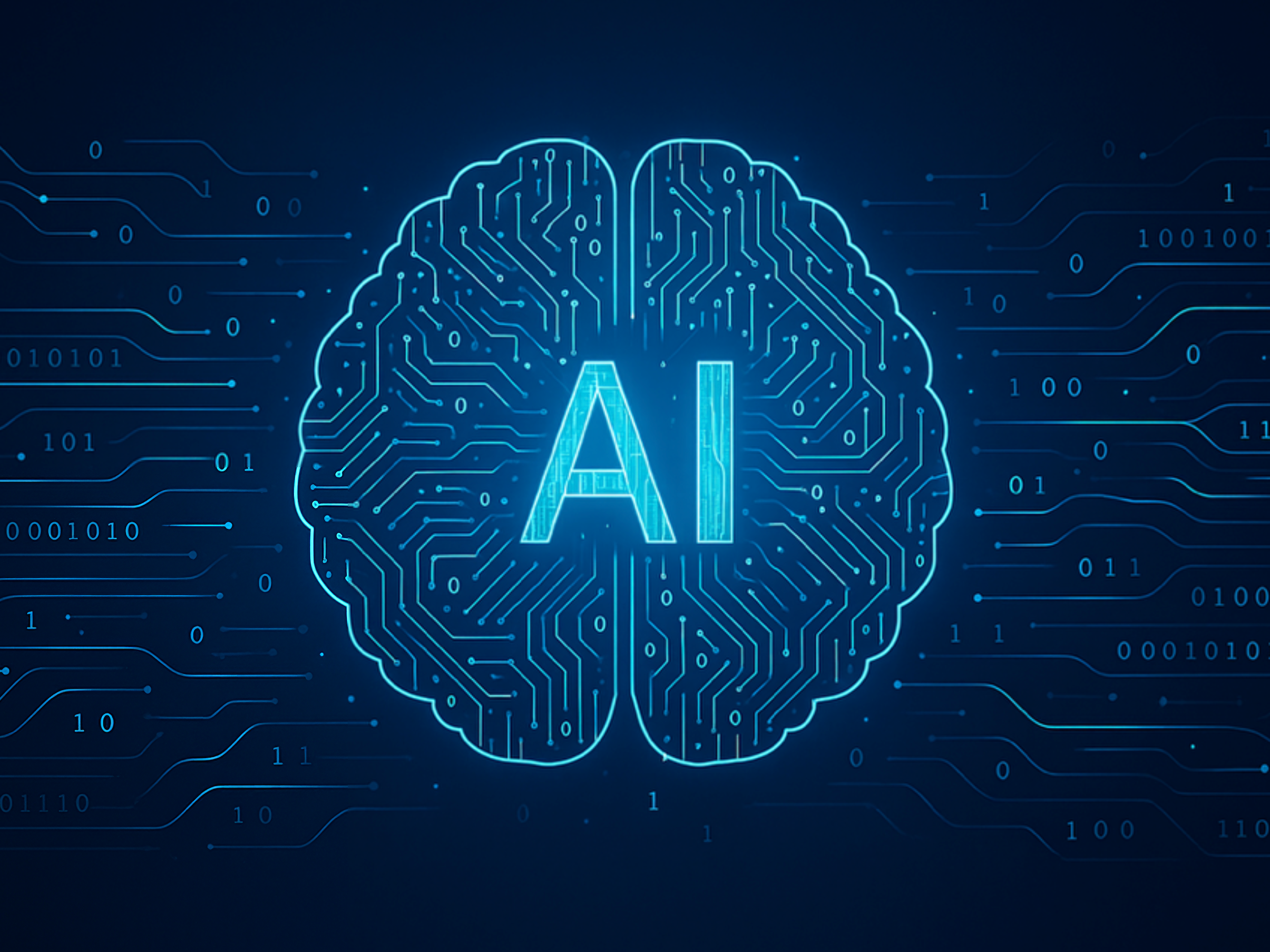Parametrische Versicherungen – bringt smartes Design den Durchbruch?

Wie groß ist das Potenzial?
Parametrische Versicherungen regulieren Schäden auf Basis einer zufälligen, mess- und modellierbaren Größe. Sie haben daher den Charakter einer Wette und lassen sich auf unterschiedliche Risiken anwenden. Dazu gehören beispielsweise meteorologische Gefahren wie Überschwemmungen oder geophysikalische Gefahren wie Erdbeben. In den 90er Jahren weckten parametrische Versicherungen große Hoffnungen etwa beim Einsatz gegen Dürren in Entwicklungsländern. In der Praxis blieb der Durchbruch zunächst aus. Gründe waren u.a. ungenaue Indizes, die Kostenstruktur und Datenmängel[1]. Angesichts eines weltweiten Versicherungsmarktes von über 8 Bill. USD[2] nimmt sich der Markt für parametrische Versicherungen mit geschätzt 16 Mrd. USD heute immer noch bescheiden aus, wächst jedoch dynamisch mit jährlich ca. 10 %[3]. Das Beispiel Flugverspätungen illustriert das Potenzial. Bei einem Entschädigungsvolumen von ca. 5-7 Milliarden Euro[4] in der EU übersetzt sich das mögliche adressierbare Prämienvolumen allein in Deutschland schätzungsweise auf 1-2 Milliarden Euro. Zwar sichern sich Fluggesellschaften bereits in Teilen gegen dieses Risiko ab. Dies führt aber weder zu automatischen Entschädigungszahlungen an betroffene Passagiere noch schließt es die Abwicklung der Zahlungen ein. So wird auf eine effiziente Regulierung großer Schadenmengen verzichtet, wie sie neuere Entwicklungen erlauben. Aufbauend auf den Erkenntnissen verschiedener Piloten zeigen wir daher im Folgenden einen kurzen Leitfaden für eine Blockchain basierte B2B2C-Versicherung auf.
Was können wir aus vergangenen Piloten lernen?
Im Markt für parametrische Versicherungen finden sich etablierte Erst- und Rückversicherer sowie InsurTechs (z. B. Blink Parametric oder Parametrix). Blockchain basierte Anwendungsfälle kamen in der Vergangenheit selten über die Pilotphase hinaus, wie sich am Beispiel der Verspätungsentschädigungen von Fahrgästen im Bahnverkehr nachvollziehen lässt. In Japan automatisierte der Versicherer Sompo schon 2020 die Entschädigung auf Basis eines Hyperledger Fabric Netzwerks[5], im Vereinigten Königreich läuft aktuell eine Testphase in den West Midlands unter Nutzung von STUB (system for ticketing ubiquity with blockchains)6. Einer nachhaltigen Skalierung standen dabei die reibungslose technische Abwicklung von Auszahlungen, mangelnde Akzeptanz aufgrund rechtlicher Herausforderungen sowie die fehlende Integration in die vorhandene Systemlandschaft entgegen. Diese Hürden können durch die richtige Wahl der technologischen Optionen sowie die Vermeidung rechtlicher Hindernisse genommen werden.
Welche technischen Möglichkeiten gibt es?
Grundlegend für die Einbettung der automatisierten Verspätungsentschädigung sind selbstausführende Verträge, sogenannten Smart Contracts. Zu deren Ausgestaltung sind auf technischer Ebene insbesondere drei Dimensionen relevant:
Erstens die Blockchain, auf der digitale Smart Contracts abgebildet werden. Hier kommen drei Ausprägungen in Betracht: Zugangsbeschränkte Blockchains (z. B. Hyperledger Fabric, Hyperledger Besu), die nur für autorisierte Teilnehmer vorgesehen sind. Öffentliche Blockchains (z. B. Polygon), die hingegen eine unbeschränkte Teilnahme erlauben und einen öffentlichen Handel der Tokens ermöglichen. Hybride Modelle kombinieren beide Ansätze, indem z. B. sensible Daten in einer zugangsbeschränkten Blockchain verarbeitet werden, während öffentliche Blockchains für Transparenz sorgen.
Zweitens ist die Wahl eines verlässliche Indexwerte liefernden Oracles zentral. Sie bilden die Schnittstelle zwischen externen Datenquellen und der Blockchain. Grundsätzlich bestehen zwei Ausprägungen: Echtzeit-Oracles können sowohl betreiberinterne als auch externe Messungen, etwa über IoT-Sensoren, einbinden. Dabei ist die Nutzung einer einzelnen Datenquelle (z. B. Navitime) ebenso möglich wie ein Mehrquellenansatz über Quorum- oder Chainlink-Logik. Nachgelagerte Oracles ohne Live-Trigger sind eine weitere Möglichkeit.
Drittens geht es um die Auszahlungsabwicklung. Diese erfolgt automatisch, sobald die Oracles Werte liefern, die die im Smart Contract definierten Schwellenwerte überschreiten. Wir sehen fünf relevante Ausprägungen, deren Kombination besonders relevant für die Akzeptanz durch Endverbraucher sein dürfte: SEPA-Überweisungen auf Basis der Ticketdaten, Escrow-basierte Rückerstattungen über Treuhandkonten, tokenisierte Wertgutscheine, NFT-Coupons, die in die Wallet ausgezahlt werden und Stablecoins. Letztere können anschließend in die jeweilige Landeswährung umgetauscht werden. Auch schnelle Off-Chain-Zahlungen außerhalb der Haupt-Blockchain sind umsetzbar.
Welche rechtlichen Überlegungen müssen beachtet werden?
Für den Einsatz von Smart Contracts im Bereich der parametrischen Versicherungen gelten rechtliche Rahmenbedingungen7 für die Bereiche Blockchain, Oracles, Auszahlungen und übergreifende Themen.
Erstens sollte eine zugangsbeschränkte Blockchain (z. B. Hyperledger Fabric) die Grundlage bilden, die „Kill Switches“8 beinhaltet, um Smart Contracts bei Bedarf sicher zu beenden. Aus der Forderung nach Privacy by Design der DSGVO9 lässt sich ableiten, dass personenbezogene Daten nicht on-chain gespeichert werden sollten.
Zweitens sollten im Zusammenhang mit Oracles gemäß DORA mindestens zwei unabhängige Datenquellen pro Indikator genutzt werden, um Fehlmessungen abzusichern. Entsprechend den Redundanzgrundsätzen10 können bei Abweichungen automatische Warnmeldungen für manuelle Überprüfungen ausgelöst werden.
Drittens ist die Vertragsgestaltung für Auszahlungen entscheidend. Parametrische Modelle unterliegen regelmäßig dem Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG). Ein Vorteil für etablierte Versicherer: Sie verfügen bereits über eine BaFin-Lizenz und befinden sich damit in einer Pole Position gegenüber Startups, die regulatorisch erst aufholen müssen. Escrow-Modelle verknüpfen Entschädigungen direkt mit der Ticketpreisstruktur und sind daher im Zahlungsdiensterecht verortet. Insgesamt ist eine Zahlung erst dann rechtlich final, wenn sie dem Kundenkonto gutgeschrieben wurde, z. B. per SEPA. Stablecoins erfüllen diese Vorgabe nicht und offenbaren somit eine Lücke in der aktuellen Regulierung.
Viertens sollten übergreifende Themen rechtlich abgesichert werden. Hierzu gehört die eindeutige Klärung von Haftungsfragen bspw. zwischen Entwicklern und Betreibern. Governance, Resilienz und Datenschutz sind ebenfalls zentrale Anforderungen. DORA verlangt einheitliche Verfahren zur Meldung von IKT-Vorfällen. IT-SiG 2.011und NIS212 verschärfen die Anforderungen noch weiter: So sind Vorfalls-Erkennungen und Berichterstattungen für Betreiber, die als Teil kritischer Infrastrukturen gelten, obligatorisch. Ebenso muss gemäß DSGVO13 die Möglichkeit bestehen, diese Daten zu löschen. Diese Verordnung verlangt zudem eine rechtmäßige Datenverarbeitung und Transparenz. Zudem fordert der EU Data Act eine nachträgliche menschliche Überprüfbarkeit automatisierter Entscheidungen. Daher sollten z. B. Escrow-Verträge stets Stornierungs- und Rückerstattungsoptionen enthalten.
Welche Chancen bieten sich Versicherern?
Unter Berücksichtigung der beschriebenen technischen Optionen und rechtlichen Vorgaben bieten sich für Versicherer Chancen insbesondere in B2B2C-Modellen, die sich in die bestehenden Prozesse von Partnerunternehmen als embedded insurance integrieren. Die industriellen Partner profitieren hier implizit auch durch die von Versicherern übernommene Abwicklung von Entschädigungszahlungen. Perspektivisch könnten weitere (Teil-)Aktivitäten an Schnittstellen übernommen werden, etwa in Form von Dienstleistungen im Bereich predictive maintenance. Die Tokenisierung von Risiken auf der Blockchain könnte Versicherern überdies perspektivisch die Weitergabe von Risiken an den Zweitmarkt erleichtern, wie es ILS (insurance linked securities) bereits heute tun.
Ausblick
Der Markt für parametrische Versicherungen bietet angesichts seiner Wachstumsraten erhebliches Potenzial und befindet sich dank technischer Fortschritte an einem entscheidenden Wendepunkt. Zudem sorgt ein immer klarer werdender rechtlicher Rahmen in der EU für Orientierung. Diese Klarheit können Versicherer in einen Vorteil übersetzen und relevante Deckungslücken mit innovativen Produkten schließen sowie durch ein erweitertes Serviceangebot neue Relevanz für ihre gewerblichen Kunden gewinnen.
Fußnoten
6 Preece, Joe & Morris, Christopher & Easton, John. (2024). Leveraging ontochains for distributed public transit ticketing: An investigation with the system for ticketing ubiquity with blockchains.
7 Sharmin N. Chougule/Parlove Bawa, Smart Contracts, IoT und Fahrgastentschädigung: Eine rechtsvergleichende Analyse der „Delay Repay“-Regelungen im Bahn- und Luftverkehr, erscheint in: Recht Digital (2025).
8 EU Data Act ART. 36
9 DSGVO ART. 5, 25
10 DORA ART. 9
11 IT-Sicherheitsgesetz 2.0
12 Netz- und Informationssicherheit-Richtlinie 2
13 DSGVO ART 17,22